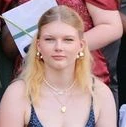So oder ähnlich ließe sich die Laufbahn der in Bochum-Linden lebenden 17-jährigen Amelia Lydia Steinicke zusammenfassen. Vor wenigen Monaten noch ein unbeschriebenes Blatt, heute bekanntes Gesicht der neonazistischen Heimatjugend/JN im Ruhrgebiet. Ihr Umfeld: einschlägig bekannte rechte Kader. Ihr Terrain: Heimatabende in Essen-Kray und Dortmund-Dorstfeld Social-Media-Profile im Stil rechter Nachwuchs-Influencerinnen. Der Fall Steinicke zeigt: Die extreme Rechte hat verstanden, dass sie im Jahr 2025 nicht nur Trommeln und Transparente braucht, sondern Gesichter: weiblic jung. Solche, die ins Netz passen.
 kuratierten Feeds auf, inszenieren sich als Kämpferinnen für „deutsche Werte“, während sie feindliche und rassistische Botschaften verbreiten. Die Zielgruppe: Teenager und junge Erwachsene, die nicht auf graue Männer in Bomberjacken anspringen, aber auf stylische Selfies mit politischer Würze.
kuratierten Feeds auf, inszenieren sich als Kämpferinnen für „deutsche Werte“, während sie feindliche und rassistische Botschaften verbreiten. Die Zielgruppe: Teenager und junge Erwachsene, die nicht auf graue Männer in Bomberjacken anspringen, aber auf stylische Selfies mit politischer Würze.In dieses Raster passt Amelia Lydia Steinicke nahezu lehrbuchhaft. Sie ist die regionale Variante dieses Typus im Ruhrgebiet: 17 Jahre alt, Social-Media-affin, anschlussfähig für eine Generation, die ihre politische Welt primär durch Feeds, Stories und Clips wahrnimmt. In den Strukturen der Heimatjugend wird sie entsprechend eingesetzt: als freundliches Gesicht einer Szene, die sich selbst gern als „Jugendbewegung“ verkauft und dafür dringend Abstand zum klassischen Neonazi-Klischee braucht. Frauen sind Schaufensterfiguren und Legitimationsvehikel: Wenn „selbst Mädchen“ sich nicht abschrecken lassen, kann das alles ja nicht so extrem sein. In geschlossenen Runden bleibt das Rollenbild gleichzeitig traditionell: Frauen als Ergänzung, nicht als Führung; als emotionale Verstärkerinnen, nicht als strategische Köpfe. Steinicke bewegt sich genau in diesem Rahmen. Sie darf im Bild vorne stehen, aber inhaltlich nur dosiert auftreten. Sie ist politisches A und Rekrutierungsfaktor und damit wichtiger Bestandteil einer modernisierten Inszenierung, die die Kontinuität der Ideologie hinter neuen Filtern verbirgt.

Elias Bialas und Amelia Steinicke am 29.08.2025 beim Offenen Abend in Dortmund-Dorstfeld Quelle: Recherche Nord
Ihre ersten Schritte in die Szene ging Steinicke gemeinsam mit Elias Bialas, einem bereits bekannten Aktivisten im rechten Ruhrgebiets-Milieu. Bialas übernimmt, was in extrem rechten Strukturen seit Jahren praktiziert wird: persönliche Ansprache als Anschluss an digitale Radikalisierung. Aus Nachrichten über Social Media werden konkrete Verabredungen. „Komm nicht allein, wir treffen uns vorher“, lautet das unausgesprochene Versprechen von Schutz und Zugehörigkeit.
Innerhalb weniger Monate wird aus eine verlässliche Teilnehmerin. Sie taucht regelmäßig bei den Heimatabenden in Essen-Kray und Dortmund-Dorstfeld auf, zuerst im Hintergrund, später sichtbar platziert. Spätestens als sie bei Aufmärschen der Heimatjugend in der ersten Reihe mit Banner läuft, ist klar: Steinicke ist nicht mehr nur Mitläuferin, sie ist Teil des präsentierten Kerns. Es ist ihr bewusster Entschluss, sich öffentlich für eine Gruppe herzugeben, die den Nationalsozialismus feiert. In einer Szene, die Nachwuchs- und Imageprobleme zugleich hat, ist eine 17-jährige Aktivistin Gold wert und wird entsprechend umworben, eingebunden, ausgestellt.
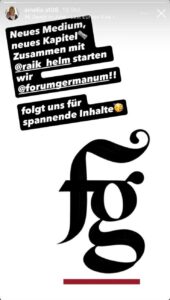
 egenentwurf zur angeblich „gleichgeschalteten“ Unikultur inszeniert. Weil die Studierenden keinen Bock auf Neonazis haben und dies auch öffentlich kundtun, verkriecht sich der zum Scheitern verurteilte Lehramtsstudent in die Opferrolle und Flucht gegen den bunten und weltoffenen Campus.
egenentwurf zur angeblich „gleichgeschalteten“ Unikultur inszeniert. Weil die Studierenden keinen Bock auf Neonazis haben und dies auch öffentlich kundtun, verkriecht sich der zum Scheitern verurteilte Lehramtsstudent in die Opferrolle und Flucht gegen den bunten und weltoffenen Campus. Der bisher letzte Beitrag des Projekts ist ein Kurzvideo über den offenen Abend in Essen am 14.11.2025. Zu sehen: Steinicke, sichtbar nervös, vor einer wackeligen Kamera. Sie erklärt, dass die Heimatjugend „trotz Gegenprotest“ wieder „Widerstand gezeigt“ habe. Der Auftritt ist unsicher, die Sätze brechen, der Blick wandert, die Körpersprache schwankt zwischen Stolz und Überforderung. Professionell ist das nicht aber darauf kommt es in erster Linie auch nicht an. Wichtig ist: Es gibt einen Clip mit jungem Gesicht, einem halbwegs klaren Satz und einem Link, der sich teilen lässt.
Beobachtet wurde das Duo auch abseits der offiziellen Settings: in Bochum, händchenhaltend beim Starbucks und vorbeihuschend an Antifa-Graffitis. Ob es sich tatsächlich um eine B
eziehung handelt oder doch nur um die übliche, kurzlebige Szene-Affäre, bleibt offen.
Für andere Jugendliche ist das attraktiv. Die Botschaft lautet: Wer in die Heimatjugend kommt, erhält nicht nur politische Heimat, sondern auch soziale Anbindung, Freundschaften, vielleicht eine Beziehung. Der ideologische Kern tritt im Alltag hinter der Normalität zurück, um dann bei Demos, Aktionen und Texten wieder klar hervorzutreten.
Auffällig ist Steinicke nicht nur in der Szene, sondern auch im Alltag. Sie besucht die Erich-Kästner-Schule in Bochum und geht dort in die 11. Klasse. Mitschüler:innen berichten von „merkwürdigen“ Aussagen im Unterricht: Relativierungen von rechter Gewalt, Nebensätzen über „mutige Patrioten“, spitzen Bemerkungen zu queeren Themen oder Geflüchteten, die sie mit einem Schulterzucken als „nur eine Meinung“ abtut. Lehrkräfte bekommen davon meist nur Ausschnitte mit, wissen aber mittlerweile um ihre Einbindung in die Neonaziszene. So schiebt sich ihr Schulalltag nahtlos neben Heimatabende und „Forum Germanum“: vormittags Klausuren, nachmittags Demo, dazwischen ein Weltbild, das längst nicht mehr nur online oder in Dorstfeld verhandelt wird, sondern mitten im Klassenzimmer.
Amelia Lydia Steinicke steht exemplarisch für eine neue Generation rechter Nachwuchsfiguren 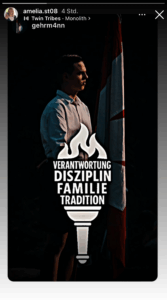 im Ruhrgebiet. Sie ist kein Ausreißer, sondern die logische Fortsetzung einer Entwicklung, in der die extreme Rechte ihr Image modernisiert, ohne ihren Inhalt zu verändern. Während die alten verbrauchten Kader Infrastruktur, Räume und ideologische Linien liefern, übernehmen Figuren wie Steinicke die Aufgabe, diese Strukturen algorithmustauglich zu verpacken: in Selfies, in TikTok-Formaten, in halb misslungenen, halb harmlos wirkenden Postings. Die Gefahr liegt gerade in dieser Mischung: Steinicke wirkt nicht wie die klassische Neonazistin, sondern wie eine 17-Jährige, die zwischen Schule, Starbucks und Heimatabend pendelt. Ihre Inszenierung macht die extreme Rechte anschlussfähig für Jugendliche, die keinen Fuß in einen Kameradschaftskeller setzen würden, aber durchaus einem Instagram-Profil folgen, das aussieht wie jedes andere, nur mit „Heimat“-Überdosis.
im Ruhrgebiet. Sie ist kein Ausreißer, sondern die logische Fortsetzung einer Entwicklung, in der die extreme Rechte ihr Image modernisiert, ohne ihren Inhalt zu verändern. Während die alten verbrauchten Kader Infrastruktur, Räume und ideologische Linien liefern, übernehmen Figuren wie Steinicke die Aufgabe, diese Strukturen algorithmustauglich zu verpacken: in Selfies, in TikTok-Formaten, in halb misslungenen, halb harmlos wirkenden Postings. Die Gefahr liegt gerade in dieser Mischung: Steinicke wirkt nicht wie die klassische Neonazistin, sondern wie eine 17-Jährige, die zwischen Schule, Starbucks und Heimatabend pendelt. Ihre Inszenierung macht die extreme Rechte anschlussfähig für Jugendliche, die keinen Fuß in einen Kameradschaftskeller setzen würden, aber durchaus einem Instagram-Profil folgen, das aussieht wie jedes andere, nur mit „Heimat“-Überdosis.
Ob Steinicke der Szene langfristig erhalten bleibt oder irgendwann aussteigt, lässt sich nicht absehen. Langjährigen Beobachter*innen der Szene ist jedoch klar, dass es für Steinicke nur zwei Lebensperspektiven geben kann: baldiger Ausstieg oder ein gescheiterter Lebenslauf. Klar ist jedoch: Solange Strukturen wie die Heimatjugend bewusst auf junge Frauen als Aushängeschilder setzen, wird die Szene nicht „harmloser“, sondern schwerer zu erkennen. Unter Softfiltern, Gelatine-Witzen und wackeligen Videostatements bleibt die Ideologie dieselbe – nur ihre Verpackung ist neu.